Pflegegrad
Im Jahr 2017 wurde das System der Pflegestufen auf Pflegegrade umgestellt. Wie die alten Pflegestufen dient es dazu, den Pflegebedarf einer Person und den damit verbundenen Anspruch auf Pflegegeld zu ermitteln. Im Mittelpunkt der Beurteilung stehen die selbstständige Bewältigung des täglichen Lebens sowie die körperlichen, geistigen und psychischen Fähigkeiten der pflegebedürftigen Person.
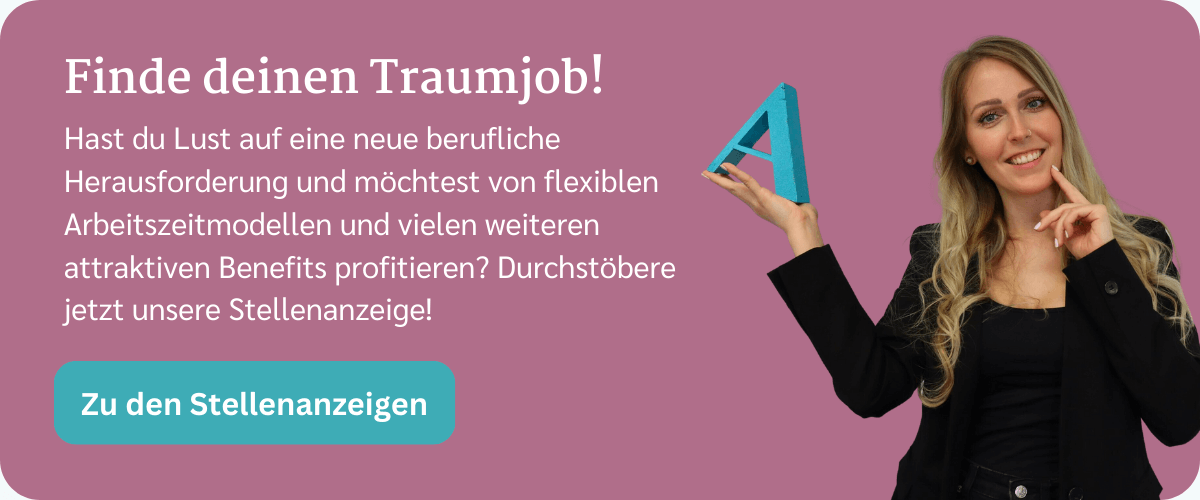
Definition Pflegegrad
Ein Pflegegrad ist eine Einstufung des Unterstützungsbedarfs von Menschen, die aufgrund körperlicher, geistiger oder psychischer Beeinträchtigungen Hilfe im Alltag benötigen. Er gibt an, wie pflegebedürftig eine Person ist und welche monatlichen Leistungen und Gelder in Anspruch genommen werden können. Pflegebedürftige erhalten von der Pflegekasse höhere Leistungen, wenn sie einen höheren Pflegegrad haben. Die Leistungen umfassen zum Beispiel die pflegerische Versorgung durch einen ambulanten Pflegedienst, die häusliche Pflege durch Angehörige oder die stationäre Pflege. Auch Pflegehilfsmittel, Pflegekurse und Betreuungsleistungen gehören zum Leistungsumfang dazu.
Die Einführung des neuen Bemessungssystems soll psychisch- und demenzkranken Menschen eine bessere finanzielle Unterstützung ermöglichen. Bei der Einstufung in die Pflegestufen waren solche Personen häufig benachteiligt, da sich das veraltete System an den körperlichen Defiziten orientierte.
Die fünf Pflegegrade
Menschen, die in ihrer Selbstständigkeit eingeschränkt sind und ihren Alltag nicht mehr ohne Hilfe bewältigen können, erhalten nach einer professionellen Begutachtung einen Pflegegrad. Dieser wird an verschiedenen Fähigkeiten bemessen und schließt körperliche, geistige und psychische Defizite ein. Je höher die Beeinträchtigungen, desto höher der Pflegegrad und die angepassten Leistungen.
Pflegegrad 1: geringe Beeinträchtigung (12,5 bis 27 Punkte)
Der niedrigste Pflegegrad gilt für Personen, die nach der alten Einteilung in Pflegestufen in die Pflegestufe 0 eingeteilt wurden und keinerlei Unterstützung von der Pflegekasse erhielten. Dank der Reformierung haben diese Menschen nun einen geringen Anspruch auf Pflegeleistungen. Personen mit dem Pflegegrad 1 können sich noch gut selbst versorgen und benötigen nur minimale Unterstützung, zum Beispiel bei der Hygiene oder hauswirtschaftlichen Versorgung.
Pflegegrad 2: erhebliche Beeinträchtigung (27 bis 47,5 Punkte
In den Pflegegrad 2 werden Bedürftige eingeordnet, deren Selbstständigkeit im Alltag bereits erheblich beeinträchtigt ist. In welchen Lebensbereichen sie Hilfe benötigen, hängt individuell von der zu pflegenden Person ab. In der Regel haben diese Patient:innen Anspruch auf eine häusliche Pflege durch Angehörige oder erhalten personelle Unterstützung durch einen ambulanten Pflegedienst.
Pflegegrad 3: schwere Beeinträchtigung (47,5 bis 70 Punkte)
Eine schwere Beeinträchtigung liegt vor, wenn die pflegebedürftige Person eine Punktzahl zwischen 47,5 und 70 Punkten erreicht. In der Regel benötigen Menschen mit dieser Einstufung mehrmals tägliche Unterstützung. Ein pflegender Angehöriger kann in vielen Fällen noch die Pflege zu Hause übernehmen, die teilstationäre Pflege oder vollstationäre Pflege bietet sich jedoch an.
Pflegegrad 4: schwerste Beeinträchtigung (70 bis 90 Punkte)
Pflegebedürftige sind häufig mobil eingeschränkt und können ihren Alltag kaum noch selbstständig bewältigen. Sie benötigen in fast allen täglichen Tätigkeiten Hilfe, weswegen eine vollstationäre Pflege meist die beste Lösung ist, um pflegende Angehörige zu entlasten und der pflegebedürftigen Person die bestmögliche Versorgung zu bieten.
Pflegegrad 5: besondere Anforderungen (90 bis 100 Punkte)
Die schwersten Beeinträchtigungen in der Selbstversorgung beschreibt der Pflegegrad 5. Personen, die diesen erhalten, haben einen sehr hohen Pflegebedarf und müssen meist rund um die Uhr betreut werden. Hierbei handelt es sich weitgehend um Menschen, die immobil und in allen täglichen Tätigkeiten auf fremde Unterstützung angewiesen sind.
Sonderregelungen bei Pflegegraden
Bei der Einstufung gibt es für bestimmte Personengruppen Sonderregelungen, die unabhängig von der erreichten Punktzahl in der Begutachtung gelten.
Bewegungsunfähigkeit von Armen und Beinen
Personen, die ihre Beine und Arme nicht mehr benutzen können, erhalten immer den höchsten Pflegegrad, unabhängig davon, ob ihre Gesamtpunktzahl in der Begutachtung unter 90 Punkten liegt.
Kleinkinder und Kinder
Personen unter zwölf Jahren werden aufgrund ihrer altersgemäßen Entwicklung mit gesunden Kindern verglichen. Für sie gilt daher ein anderer Bewertungsmaßstab als für Erwachsene. Darüber hinaus werden Kleinkinder bis zu einem Alter von 18 Monaten grundsätzlich eine Pflegestufe höher eingestuft.
Bewertungsgrundlage für die Einstufung in einen Pflegegrad
Im Januar 2017 wurde mit dem Pflegestärkungsgesetz (PSG II) auch das neue Begutachtungsassessment (NBA) eingeführt. Bei der Einstufung spielt die Selbstständigkeit, die anhand der körperlichen, geistigen und psychischen Verfassung gemessen wird, eine große Rolle. Die Bewertung erfolgt nach einem Punktesystem. Um den richtigen Pflegegrad zu ermitteln, prüfen professionelle Gutachter die vorhandenen Fähigkeiten sowie die alltäglichen Beeinträchtigungen der Pflegebedürftigen und vergeben entsprechend Punkte für festgelegte Lebensbereiche (sogenannte Module). Am Ende werden die Punkte aus allen Bereichen mit unterschiedlicher Gewichtung zusammengerechnet und daraus einer der fünf Pflegegrade ermittelt.

Modul 1: Mobilität
In diesem Modul beurteilen die Gutachter die körperliche Beweglichkeit der zu pflegenden Person. Dazu gehören alltägliche Bewegungen wie das aufrechte Sitzen, Aufstehen, Treppensteigen oder das Umdrehen im Bett.
Modul 2: Kognitive und kommunikative Fähigkeiten
Für die selbständige Bewältigung des Alltags spielen geistige und sprachliche Fähigkeiten eine wichtige Rolle. Hier wird geprüft, ob sich die betroffene Person zeitlich und räumlich orientieren, Personen in der näheren Umgebung erkennen und selbständig Entscheidungen treffen kann.
Modul 3: Verhaltensweisen und psychische Problemlagen
Auch die mentale Gesundheit wird bei der Einstufung in den jeweiligen Pflegegrad beurteilt. Dazu gehören Verhaltensauffälligkeiten wie Ängste, Depressionen, nächtliche Unruhe oder Aggressionen.
Modul 4: Selbstversorgung
In diesem Modul prüfen die Gutachter, inwiefern sich die betroffene Person noch selbständig versorgen kann. Alltägliche Tätigkeiten wie das Duschen, Ankleiden, Essen und Trinken und der Toilettengang zählen zu diesem Modul.
Modul 5: Bewältigung krankheits- und therapiebedingter Anforderungen
Das Modul beschreibt die eigenständige Umsetzung ärztlicher Verordnungen. Es wird geprüft, ob die pflegebedürftige Person ihre Medikamente selbst einnehmen kann oder Unterstützung bei der medizinischen Versorgung benötigt.
Modul 6: Alltagsgestaltung und soziale Kontakte
Die Begutachter setzen sich in diesem Modul mit der Organisation des Alltags der betroffenen Person auseinander. Das Knüpfen von Freundschaften und sozialen Kontakten sowie die selbständige Planung des täglichen Lebens spielen eine Rolle.
Pflegegrad beantragen
Zur Beantragung eines Pflegegrads (ehemals Pflegestufe) wendet sich die pflegebedürftige Person oder ein Familienmitglied an die zuständige Pflegekasse. Dort erhält sie detaillierte Informationen und alle benötigten Unterlagen für den Antrag auf Pflegeleistungen. Die Begutachtung zur Feststellung des jeweiligen Pflegegrads erfolgt bei gesetzlich Versicherten durch einen Gutachter des Medizinischen Dienst (MDK). Bei privat Versicherten ist die Firma Medicproof für das Gutachten zuständig. Der Befund wird anschließend zur Prüfung an die Pflegekasse weitergeleitet, um individuell zu ermitteln, welche finanzielle Unterstützung und Leistungen der zu pflegenden Person zustehen.
Leistungen bei einem Pflegegrad
Je nach zugeordnetem Pflegegrad stehen pflegebedürftigen Angehörigen verschiedene Leistungen zur Verfügung, um ihren Unterstützungsbedarf abzudecken. Dazu gehören unter anderem:
Pflegegeld
Die Pflegekasse zahlt das Pflegegeld direkt an die bedürftige Person. Es kann verwendet werden, um die Pflege durch Angehörige oder andere Pflegepersonen zu finanzieren. Die Höhe des Pflegegeldes richtet sich nach dem jeweiligen Pflegegrad.
Sachleistungen
Bei Sachleistungen übernimmt ein professioneller Pflegedienst die Pflege und Unterstützung im Alltag. Dazu gehören beispielsweise die Hilfe bei der Körperpflege, beim Essen oder bei der Hauswirtschaft. Die Kosten für die Sachleistungen werden mit dem Pflegedienst abgerechnet.
Tages- und Nachtpflege
In der Tagespflege oder Nachtpflege erhalten pflegebedürftige Menschen tagsüber bzw. nachts in einer speziellen Einrichtung eine stationäre Versorgung. Dort werden sie professionell betreut und können an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen.
Kurzzeitpflege
Die Kurzzeitpflege ist die vorübergehende Unterbringung und Betreuung von Patient:innen in einer Pflegeeinrichtung. Sie entlastet pflegende Angehörige und dient als Überbrückung nach einem Krankenhausaufenthalt bis zur Entlassung nach Hause.
Verhinderungspflege
Wenn die Pflegeperson vorübergehend ausfällt oder eine Auszeit benötigt, greift die Verhinderungspflege. In diesem Fall übernimmt eine Ersatzpflegekraft die Pflege.
Häufig gestellte Fragen
Ein Pflegegrad ist eine Einstufung, die den individuellen Pflegebedarf einer Person in Deutschland bewertet. Er wird durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) festgelegt und dient zur Bestimmung der Leistungen der Pflegeversicherung.
Pflegebedürftige mit anerkanntem Pflegegrad haben Anspruch auf Leistungen aus der Pflegeversicherung. Dazu gehören finanzielle Unterstützung für ambulante Pflegeleistungen, Tages- und Nachtpflege, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege sowie vollstationäre Pflege. Zudem können Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel beantragt werden.
Eine rückwirkende Beantragung ist möglich. Der Anspruch auf Pflegeleistungen beginnt jedoch erst ab dem Datum der Antragstellung. Es empfiehlt sich daher, den Antrag so früh wie möglich zu stellen, um finanzielle Einbußen zu vermeiden.